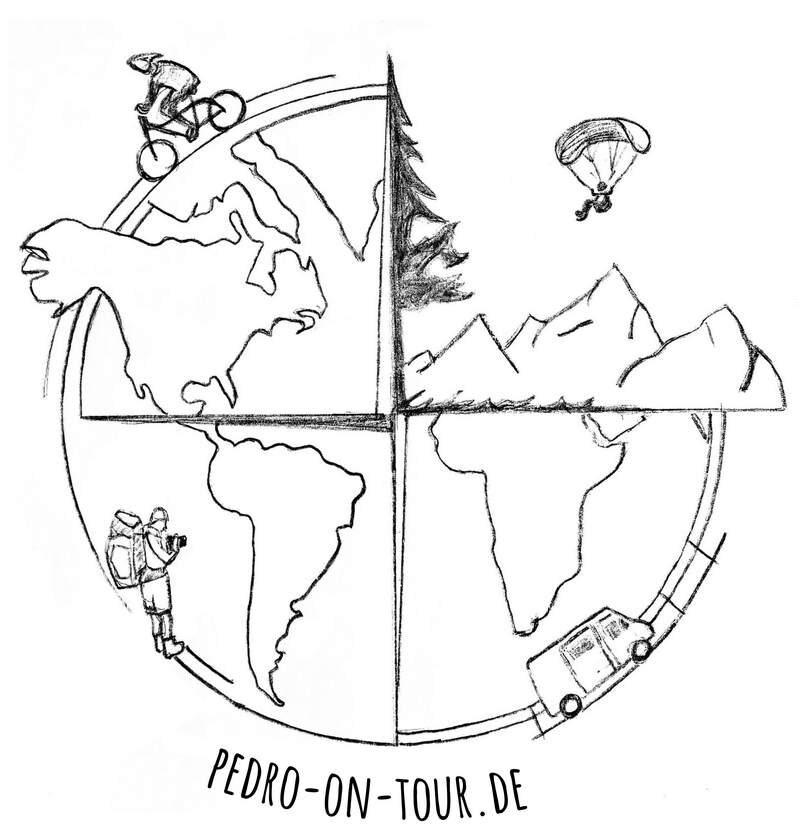|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Cusco und der Süden Perus
Wir haben noch einen guten Monat Zeit, bevor unser 90-tägiges Visum in Peru erneut ausläuft. Außerdem haben wir mit Pedros Käufern vereinbart, dass wir ihnen Pedro spätestens am 1. Dezember übergeben. Das sind zwar noch zweieinhalb Monate, aber in dieser Zeit wollen wir noch einiges in Peru entdecken, in Bolivien den Titicacasee besuchen – und anschließend müssen wir ja auch noch bis nach Santiago de Chile fahren. Also haben wir, zumindest im Vergleich zur bisherigen Reise, diesmal leider auch ein bisschen Zeitdruck. Vorher möchten wir in Peru vor allem in der Gegend um Cusco noch einiges unternehmen.
Über Lima nach Ayacucho
Wir hatten überlegt, die Strecke nach Cusco quer durch die Berge zu fahren. Die Küste kennen wir ja schon von unserer Fahrt nach Norden im Januar. Nach Rücksprache mit unseren Freunden Pit und Nicole, die die gesamte Strecke mit Piccolo – ihrem Allrad-VW-Bus – gefahren sind, haben wir uns jedoch dagegen entschieden und nehmen nun lieber die schnellere Route entlang der Küste. Von hier nach Cusco sind es etwa 600 km Luftlinie – auf deutschen Autobahnen auch mit Pedro locker eine Tagesetappe, durchs peruanische Hochland jedoch ein Abenteuer, das uns sicher zwei Wochen extra kosten würde. Und leider läuft unser Visum für Peru schon in vier Wochen ab.
Also geht’s wieder runter zur Küste, am Pazifik entlang nach Süden und von Pisco aus dann wieder in die Berge nach Ayacucho. In Lima machen wir nochmal einen kurzen Stopp, um Pedro ein letztes Mal neue Stoßdämpfer an der Hinterachse zu spendieren. Wir wollen ihn unseren Nachfolgern ja in möglichst gutem Zustand übergeben.
Ayacucho ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Süden Perus. Die Stadt war einst eines der Zentren des “Sendero Luminoso”, des Leuchtenden Pfades – einer linksextremen Guerillaorganisation, die in den 1980er Jahren in Teilen Perus Anschläge auf Dörfer, Wahllokale und Politiker verübte und später bewaffnete Konflikte auslöste, die Bürgerkriegscharakter hatten. Heute findet man in der Stadt vor allem viel traditionelles Textilhandwerk.
Wir verbringen zwei Tage in dem netten Städtchen, bevor es dann durch die Berge weiter nach Cusco geht. Die Straßen in den Bergen im Süden Perus sind zwar deutlich besser als im Norden, aber die Fahrt zieht sich trotzdem hin, und Pedro muss viele tausend Höhenmeter bewältigen, bis wir in der Gegend von Cusco ankommen. Nach zweieinhalb Tagen erreichen wir schließlich das Urubamba-Tal.
Im heiligen Tal
Das Urubamba-Tal, bekannter unter dem Namen Valle Sagrado – das Heilige Tal –, liegt nordwestlich von Cusco in den Bergen. Es war schon zu Zeiten der Inka ein landwirtschaftlich sehr ertragreiches Tal, und so sind hier auch heute noch viele, teils gut erhaltene Bauwerke zu sehen.
Ollantaytambo
Wir starten unseren Besuch in Ollantaytambo. Der Legende nach soll die Stadt auf Anweisung des Gottes Viracocha von den Inka errichtet worden sein. Historiker vermuten allerdings zum Teil, dass sie bereits von den Tiwanaku, also lange vor der Hochphase der Inka, gegründet und von diesen später wiederaufgebaut und erweitert wurde. Wer auch immer sie gebaut hat – wir sind beeindruckt von den teils beeindruckend präzise gearbeiteten Steinmauern, die nicht einfach aus gleichförmigen Steinziegeln bestehen, sondern aus riesigen Blöcken, die so perfekt aneinanderpassen, dass man kaum ein Blatt Papier dazwischen bekommt.
Wir besichtigen mit einigen tausend anderen Touristen die Ruinen und danach das heutige Städtchen, essen wie gewohnt am Markt zu Mittag und steigen anschließend noch hoch zu drei Häusern, die ein ganzes Stück oberhalb der Stadt an einen steilen Hang gebaut wurden. Man vermutet, dass es Lagerhäuser für Nahrung waren, aber ganz sicher ist das nicht. Was aber sicher ist: Von dort oben hat man einen beeindruckenden Blick über die Stadt und das umliegende Tal – und auch die Gebäude selbst sind sehenswert.
Delphine riskiert noch kurz ihr Leben – zumindest aus meiner Sicht –, als sie in einer etwas waghalsigen Kletteraktion ihren vom Wind den steilen Hang hinuntergewehten Hut zurückholt. Danach geht’s wieder runter ins Dorf.
Bei den Salzterrassen
Am Abend fahren wir weiter in Richtung der Salinas de Maras, die wir uns morgen ansehen wollen, und übernachten direkt vor dem Eingang eines Seitentals, in dem diese alten Salzabbaustätten liegen. Wir möchten die Terrassen am liebsten gleich beim ersten Sonnenlicht sehen, aber vielleicht kommen wir auch am Nachmittag nochmal zurück – wir wissen nämlich nicht genau, wann das Licht für Fotos am schönsten ist.
Am Morgen gehen wir direkt zur Kasse, um unsere Tickets zu kaufen. Es ist zwar schon offen, aber einen Kassierer gibt es noch nicht. Der Mann, den wir dort antreffen, ist der Nachtwächter. Er würde uns gerne ein Ticket verkaufen, hat aber keins. Nach etwas Hin- und Herdiskutieren erhalten wir von ihm einfach einen handgeschriebenen Zettel, der als provisorisches Ticket gilt. Den sollen wir dann beim Kassierer, wenn dieser da ist, gegen ein offizielles umtauschen.
Wir fahren also weiter ins Tal hinunter und sehen schon nach ein paar Kurven die ersten der ungefähr viertausend Salzterrassen. Hier wird bereits seit über tausend Jahren, also noch vor der Zeit der Inka, Salz gewonnen. Das Wasser stammt aus einem kleinen, aber sehr salzhaltigen Bach, der oberhalb der Terrassen aus dem Berg sprudelt. Es wird in flache, aus Lehm geformte Becken geleitet, die terrassenförmig an den Hang gebaut wurden. Mit der Zeit entstanden immer mehr dieser Becken, die sich nun weit die steilen Hänge hinabziehen. Über verschlungene Rinnen gelangt das Wasser zuverlässig auch zu den weiter entfernten Becken. Diese werden ein- bis zweimal im Jahr mit neuem Salzwasser gefüllt und anschließend zum Trocknen stehen gelassen.
Das Salz wird später mehrmals umgeschichtet, in Säcke gefüllt und von den Arbeitern auf dem Rücken zu den Verladestellen am Rand der Terrassen getragen. Auf diese Weise werden mehrere Tonnen Salz pro Jahr gewonnen. Betrieben werden die Salinas von zahlreichen Familien aus zwei Gemeinden in der Umgebung, der Verkauf erfolgt inzwischen über eine gemeinschaftliche Genossenschaft. Vor allem das Speisesalz von hier ist weit bekannt.
Wir bestaunen die mosaikartig angeordneten, in unterschiedlichen Weiß- und Brauntönen schimmernden Becken zunächst von der Straße, die in die enge Schlucht hinunterführt, und erkunden die Anlage anschließend auf einem eigens für Touristen angelegten Rundweg – denn die Salinas sind natürlich längst auch eine wichtige Einnahmequelle.
Wir können uns kaum sattsehen an den Formen und Farben. Faszinierend ist auch, den Arbeitern zuzusehen, wie sie das Salz von einer Ecke in die andere schaufeln, schwere Säcke auf den schmalen Stegen zwischen den Becken tragen und das Wasser zu den verschiedenen Terrassen leiten.
Aber irgendwann haben auch wir – fürs Erste – genug. Wir wollen heute noch nach Moray, wo die Inka offenbar erste Forschungen zum Anbau von Gemüse und Getreide in unterschiedlichen Höhen durchgeführt haben. Also gehen wir am späten Vormittag zu Pedro zurück und fahren die enge, kurvige Straße wieder hinauf nach Moray. Zuvor halten wir jedoch noch einmal bei der Kasse an und fragen, ob wir mit unserem „Ticket“ – also dem handgeschriebenen Zettel von heute Morgen – am Nachmittag nochmals zu den Salinas dürfen. Tatsächlich wissen hier schon alle Bescheid und geben uns grünes Licht.
In Moray haben die Inka mehrere trichterförmige Vertiefungen genutzt oder angelegt, in denen sie ringförmige Terrassen von unten nach oben in Stufen gebaut haben. So konnten sie vermutlich verschiedene Pflanzensorten unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen testen. Genauer weiß man es nicht. Die spanischen Eroberer haben leider alle Inka getötet und dabei kaum begriffen, welches Wissen und welche Kultur sie damit zerstörten.
Wir besuchen noch kurz den Ort Maras und fahren dann am Nachmittag tatsächlich noch einmal zu den Salzterrassen zurück. Mit unserem handgeschriebenen Ticket dürfen wir problemlos wieder hinein und genießen dieses faszinierende Tal im Abendlicht.
Chinchero
Bevor es nach Cusco geht, wollen wir noch die kleine Ortschaft Chinchero besuchen, die vor allem für ihren großen Sonntagsmarkt bekannt ist. Wir kommen allerdings am Donnerstagabend an und werden wohl nicht bis Sonntag bleiben.
Wir übernachten direkt im Zentrum, auf dem Parkplatz, und machen uns am nächsten Morgen auf den Weg durch die Stadt. Auch ohne Markt gibt es hier jede Menge schönes Textilhandwerk zu sehen. Wir werden eingeladen, uns eine kleine Vorführung anzusehen, bei der die Verarbeitung der Wolle von Schafen, Alpakas und Lamas gezeigt wird. Vom Scheren über das Färben mit natürlichen Mitteln bis hin zur Fertigstellung von Mützen, Ponchos und Teppichen wird alles anschaulich erklärt, und wir lassen uns auch überreden, ein paar Dinge zu kaufen. Jetzt, wo die Reise zu Ende geht und wir schon vieles von Cartagena aus mit Julian und Katja heimschicken konnten, haben wir wieder etwas Platz in Pedro, um ein paar schöne Sachen für Familie und Freunde mitzunehmen.
Nachdem wir einige Handwerksbetriebe und Geschäfte besucht haben, kommen wir etwas weiter oben zum Stadtplatz mit der angrenzenden schönen Kirche. An einer Ecke des Platzes steht eine größere Gruppe und spielt ein lustiges Spiel: An einem etwa vier Meter hohen Pfosten ist oben eine Schnur befestigt, an deren anderem Ende – in etwa anderthalb Metern Höhe – ein kleines Stoffsäckchen mit Sand hängt. Zwei Spieler treten gegeneinander an, jeweils mit einem eigenen Spielfeld bis zur Mittellinie, an der der Pfosten steht. Spieler A muss das Säckchen im Uhrzeigersinn um den Pfosten schleudern, Spieler B gegen den Uhrzeigersinn. Wenn die Schnur vollständig um den Pfosten gewickelt ist und das Säckchen diesen berührt, hat der Spieler gewonnen.
Wir gehen näher heran und werden prompt eingeladen, es selbst zu probieren. Delphine hält sich wacker, ich bin dagegen ziemlich schnell besiegt. Das Ganze ist wie ein superschnelles Ballspiel – nicht meine Stärke, aber wirklich lustig.
Es stellt sich heraus, dass die Gruppe, mit der wir gerade spielen, die Belegschaft des kleinen Museums direkt an der Ecke ist, in dem die Geschichte des Ortes erzählt wird. Wir plaudern ein wenig mit der lustigen Truppe und werden schließlich noch auf einen Becher Inka Cola eingeladen.
Inka Cola ist ein gelbliches Süßgetränk, das wir hier schon oft gesehen haben. Ich habe schon einmal daran gerochen und wollte es danach lieber nicht probieren, aber diesmal sagen wir natürlich nicht nein. Es schmeckt schlimmer, als es riecht – unglaublich süß, da kann Coca-Cola einpacken – und der Geschmack erinnert ein bisschen an ultrakonzentriertes Gummibärchen-Aroma. Aber das ist ja alles Geschmackssache. In Peru und den Nachbarländern wird jedenfalls eine Menge davon konsumiert. Dafür wird hier generell recht wenig Alkohol getrunken – vielleicht ist das Zuckerzeug also das kleinere Übel. Wir machen noch einen Spaziergang durch die Inka-Ruinen der Stadt und fahren am Abend weiter nach Cusco.
Cusco
In Cusco warten schon wieder einige alte Bekannte auf uns. Sylvia und Matthias aus München sind gerade in der Stadt, und auch Anja und Bernhard, die nur noch in ihrem LKW leben und reisen, machen hier Station. Und natürlich sind wir alle wieder auf demselben Stellplatz. Quinta Lala, ein paar Kilometer oberhalb des Stadtzentrums, ist ein sehr netter Overlander-Campingplatz, den eine einheimische Familie betreibt.
Zur Feier des Wiedersehens gehen wir am Abend gleich mal schön essen. Es gibt mal wieder Sushi – wie so oft in Peru mit vielen lokalen Gewürzen und Zutaten – und es ist richtig lecker.
Die nächsten Tage verbringen wir damit, die Stadt zu besichtigen – unter anderem wieder mit einer Free Walking Tour – und an Pedro gibt es auch noch einiges zu tun: hinten mal wieder neue Stoßdämpfer einbauen, die fragilen Jalousien unserer Fenster ausbauen und reinigen und vieles mehr. Auch Brigitte und Bernhard, die wir zum ersten Mal im Norden Kolumbiens getroffen haben, stehen wenig später auf dem Platz, und wir verbringen noch einen sehr schönen Abend zusammen. So ist es eine Mischung aus Kultur, Arbeit und Freunde treffen. Ach ja, zwischendrin habe ich auch noch einen Termin am Konsulat: Mein neuer Reisepass wartet hier auf mich. Den Pass abzuholen ist relativ einfach, danach muss ich aber beim Zoll und bei der Ausländerbehörde den alten Pass austragen und den neuen eintragen lassen, damit ich am Ende auch wirklich legal wieder aus dem Land reisen kann. Ein Teil davon geht inzwischen online, ein paar zusätzliche Behördengänge bleiben uns aber trotzdem nicht erspart. Aber auch das ist irgendwann geschafft.
Cusco selbst ist zwar sehr touristisch, hat aber trotzdem seinen typischen peruanischen Flair bewahrt. Der Sage nach wurde die Stadt vom ersten Inka gegründet, der ein Sohn der Sonne gewesen sein soll. Tatsächlich gab es Cusco, dessen Name aus dem Quechua übersetzt „Nabel der Welt“ bedeutet, wohl schon vor der Inkazeit. Für die Inka war sie aber die Hauptstadt ihres Reiches und damit das Zentrum ihrer Welt.
Es macht Spaß, einfach durch die Innenstadt zu laufen, die Leute zu beobachten, Straßenmusikern zuzuhören und die vielen Plätze und Gassen auf sich wirken zu lassen. Dazu kommen zahlreiche interessante Museen und alte Gemäuer. Die Inka hatten hier ihre Hauptstadt, und in der Stadt stehen noch einige Gebäude, deren Fundamente oder Mauern zumindest teilweise aus den alten Inka-Steinen bestehen. Diese sind wieder super präzise gefertigt, und jeder Stein ist exakt seinem Nachbarn angepasst. Einige Steine haben acht, neun oder zehn Ecken, einer sogar zwölf. Es gibt viele Theorien dazu, wie diese präzise Fertigung funktioniert hat, aber keine davon ist abschließend belegt, und bis heute hat scheinbar niemand ernsthaft versucht, diese Art Mauerwerk originalgetreu nachzubauen. Sicher ist nur, dass die Inka viele der von ihnen besiegten Völker versklavt haben und ihnen dadurch eine große Menge an billigen Arbeitskräften zur Verfügung stand, um Städte und Kultstätten zu errichten.
So auch bei den berühmten Ruinen von Sacsayhuamán – einer Festung oder Kultstätte der Inka gleich neben unserem Campingplatz. Hier sollen über fünfzig Jahre lang rund 20.000 Menschen gearbeitet haben, um unzählige riesige Felsblöcke in Form zu bringen und damit große Gebäude und Mauern zu errichten. Einige der Steine sind mehrere Meter hoch und trotzdem so präzise bearbeitet, wie es heute kaum jemand machen könnte.
Am Ende unseres Aufenthalts in Cusco finden wir im Süden der Stadt noch eine Schweißerei, die für ihre ordentlichen Blecharbeiten an Autos bekannt ist. Da Pedro inzwischen einige größere Löcher, vor allem im unteren Teil der Karosserie, hat, wollen wir ihn noch einmal herrichten lassen, bevor wir ihn verkaufen. Also stehen wir einen Tag lang vor dem Betrieb – im Hof ist nicht genug Platz für Pedro – und während wir drinnen unsere Bilder bearbeiten, wird draußen geflext, geklopft, geschweißt und am Ende auch noch lackiert, bis Pedro besser aussieht, als wir ihn je kannten. Der Lack wird zwar sicher nicht ewig halten, aber die Metallarbeiten aus alten Karosserieblechen sind sehr gut gemacht und würden wohl auch beim deutschen TÜV ohne Weiteres durchgehen.
Danach machen wir uns mal wieder fertig für eine mehrtägige Wandertour. Wir wollen die alte Inkastadt Choquequirao sehen. Dorthin führt jedoch nur ein langer Fußmarsch – Straßen gibt es keine.
Auf nach Choquequirao
Choquequirao ist eine alte Inkastadt, die lange Zeit etwas in Vergessenheit geraten war. Zu Zeiten der Inka war sie eine wichtige Verbindung zwischen Cusco und dem Amazonas-Tiefland. Außerdem war die Stadt aufgrund ihrer abgeschiedenen Lage in den Bergen die letzte Bastion der Inka während der Eroberung Perus durch die Spanier. Aufgrund dieser Lage begann man mit den Ausgrabungen der Stadt aber erst in den 1970er-Jahren – lange nach dem viel bekannteren Machu Picchu.In Machu Picchu ist Delphine schon vor einigen Jahren gewesen. Ich bin mir lange nicht sicher, ob ich mir den Touristenrummel dort antun möchte, zumal wir gelesen hatten, man solle die Tickets mindestens sechs Monate vor dem Besuch reservieren. Unmöglich bei unserer Art zu reisen. Aber dazu später mehr.
Choquequirao ist zwar auch kein Geheimtipp mehr, aber derzeit muss man mehrere Tage lang steil bergauf und bergab durch mehrere Täler laufen – idealerweise mit der Unterstützung einheimischer Führer und Maulesel für das Gepäck und manchmal auch für erschöpfte Gäste, wie wir noch sehen werden. Und so war die Tour nach Choquequirao schon lange ein Wunsch von uns beiden. Als wir uns dann genauer damit beschäftigt haben, wurde klar, dass man nicht nur denselben Weg hin und zurückgehen muss, sondern dass es auch eine Verbindung von Choquequirao nach Norden in das kleine Dörfchen Yanama gibt. Von dort führt dann wieder eine Straße nach Santa Teresa, dem Ausgangspunkt für die Tour nach Machu Picchu.
Unser Plan ist es also, Pedro in Cusco zu lassen, mit dem Taxi nach Capuliyoc, dem Ausgangspunkt der Wanderung, zu fahren und dann nach Choquequirao und weiter nach Yanama zu laufen.
Von Capuliyoc nach Choquequirao
Choquequirao Tag 1; 8 km, 1.000 Hm bergab
Man kann auch mit verschiedenen Bussen und Collectivos zum Ausgangspunkt unserer Tour fahren, aber dann müssten wir ziemlich oft umsteigen und wären erst spät abends dort. Deshalb gönnen wir uns den Luxus eines Taxis. Delphine hat letztens die Nummer eines Uber-Fahrers aufgeschrieben, der meinte, er würde solche Fahrten auch machen, und so kontaktieren wir ihn. Er fährt uns über immer schmaler werdende Bergstraßen nach Capuliyoc, wo wir am Nachmittag gleich die erste Etappe starten.
Zu Beginn müssen wir noch ein Ticket für den Trek inklusive Eintritt und Camping für Choquequirao kaufen, das umgerechnet etwa 20 Euro kostet. Dann geht’s auch schon los – heute erstmal hauptsächlich abwärts. Über tausend Höhenmeter, um genau zu sein. Wir müssen hinunter ins Tal des Río Apurímac, bevor wir auf der anderen Talseite wieder hinauf nach Choquequirao können. Also schultern wir die Rucksäcke und los geht’s. Heute geht es allerdings noch nicht ganz hinunter bis zum Fluss, sondern nur bis Chiquisca, einem Campingplatz mit ein paar Hütten, bei dem wir uns gleich zu Beginn eine feste Unterkunft mit Bett und Essen gönnen. Zelten und unser eigenes Essen kochen können wir später immer noch. Wir treffen gleich ein paar andere Wanderer und haben einen gemütlichen Feierabend mit Blick in die Berge.
Choquequirao Tag 2; 12 km, 300 Hm bergab, 1.600 Hm bergauf
Am nächsten Morgen gibt es noch ein schönes Frühstück mit Blick in das Tal, in das wir gleich absteigen werden. Dann werden die Rucksäcke wieder geschultert und wir laufen los. Zunächst ist die Temperatur noch erträglich, und es geht gleichmäßig hinunter zum Fluss. Als wir unten sind, steht die Sonne schon höher und wir fangen langsam an zu schwitzen. Über eine recht neue Hängebrücke geht es über den Fluss und dann gleich steil bergauf.
Der Weg zieht sich ganz schön in die Länge. In Serpentinen geht es durch buschige Hänge und Wald bergauf. Die Sonne brennt die ganze Zeit auf den Hang, und wir schwitzen wie schon lange nicht mehr. Gegen Mittag erreichen wir Santa Rosa Alta und gönnen uns eine Pause. Danach geht es noch einmal ordentlich hinauf, bis wir am späten Nachmittag nach etwa achteinhalb Kilometern und 1.500 Höhenmetern in Marampata ankommen – einem kleinen Weiler, dessen Bewohner inzwischen hauptsächlich von den Wanderern leben. Es gibt hier einige Unterkünfte und auch ein paar Läden.
Aber wir wollen heute noch bis Choquequirao. Also machen wir nur kurz Pause und weiter geht’s die letzten dreieinhalb Kilometer bis zu unserem Ziel. Der Weg verläuft nun leicht bergauf und bergab und schlängelt sich an engen Hängen entlang. Nach einer Weile sehen wir die ersten der vielen Terrassen von Choquequirao, auf denen die Inka ihr Obst und Gemüse angebaut haben. Gegen Abend kommen wir schließlich an unserem Ziel an, wo es auch einen kleinen Campingplatz gibt. Von hier aus sind wir morgen ziemlich schnell im Zentrum der Stadt – ein Vorteil gegenüber den geführten Touren, die in Marampata übernachten und morgens erst noch eine Stunde hierher laufen müssen.
Wir schlagen unser Zelt auf, kochen Abendessen und kriechen nach dem langen Tag erschöpft, aber zufrieden in unsere Schlafsäcke.
Choquequirao: Ruinen, Lamas und Riesenspinnen
Choquequirao Tag 3; 12 km, 1.000 Hm bergab, 700 Hm bergauf
Heute wollen wir vor allem die alte Stadt besichtigen. Wir packen nach dem Frühstück trotzdem alles ein und nehmen die voll bepackten Rucksäcke mit ins Zentrum, denn heute Abend werden wir noch in Richtung Norden weiterlaufen und im Abstieg ins nächste Tal übernachten.
Also verstecken wir unsere Campingsachen und alles, was wir zunächst nicht brauchen, im Gebüsch und machen uns auf zur Besichtigungstour. Das Wetter ist leider nicht besonders schön, immer wieder ziehen Wolken durch die Berge, aber immerhin regnet es nicht. Wir bestaunen erneut die beeindruckenden Bauwerke, die die Inka hier weit oben in den Bergen angelegt haben: nicht nur einige teils recht große Häuser, die erstaunlich gut erhalten sind, sondern auch sehr viele, sehr steile Terrassen, auf denen Landwirtschaft betrieben wurde. Es ist nicht ganz klar, wo die Steine für all diese Bauten herkamen. Wahrscheinlich wurden sie aus den Flusstälern, die gut 1.500 Meter tiefer liegen, hierherauf gebracht. Maultiere und Pferde kannten die Inka damals noch nicht, nur Lamas – und Sklaven.
Gegen Mittag gehen wir zu den sogenannten Lama-Terrassen, einem der Highlights der Anlage. Hier haben die Erbauer in die Stützmauern der Terrassen mit hellen Steinen viele Lamas eingearbeitet, was die ohnehin schon imposanten Bauwerke noch eindrucksvoller macht. Wir steigen über extrem steile Treppen gute 200 Meter ab, um das Ganze auch von unten zu bewundern. Zum Glück gibt es teilweise einen neben den Originaltreppen angelegten Wanderweg, auf dem wir absteigen können. Die alten Stufen sind so steil, dass ich mich stellenweise kaum traue, vorwärts hinunterzugehen. Wir können uns kaum vorstellen, wie die Menschen hier früher mit Lasten hoch und runter gelaufen sind. Wer hier fällt, könnte mit ein bisschen Schwung locker ein paar hundert Höhenmeter im Flug überwinden.
Nachdem wir im Aufstieg dann direkt über die alten, steilen Treppen wieder hochgestiegen sind, laufen wir noch ein wenig durch das „Zentrum“ der alten Stadt, bevor wir unsere Rucksäcke wieder vollpacken und uns auf den Weg zu unserem nächsten Schlafplatz machen. Zunächst geht es noch durch die oberen Teile der Anlage, die wir bisher nicht gesehen haben, dann durch dichtes Gestrüpp weiter den Berg hinauf und irgendwann wieder hinunter. Unterwegs sollte es noch eine Quelle geben, deshalb haben wir nicht besonders viel Wasser dabei. Als wir in dem Bereich ankommen, in dem die Quelle laut Karte sein sollte, finden wir allerdings kein Wasser. Mist. Wir werden zwar nicht gleich verdursten, aber viel mehr als ein paar Schlucke zu trinken haben wir nicht. Und das Abendessen wird ohne Wasser zum Kochen eher karg. Na gut, mal sehen, was noch kommt.
Wir wollen noch weiter hinunter, wo es angeblich einen Platz zum Campen gibt. Als wir dort ankommen, ist es schon fast dunkel, und der Platz macht keinen besonders einladenden Eindruck: viel Müll, kaum ebene Stellflächen. Aber auf der anderen Seite des Weges führen ein paar alte Inka-Terrassen den Hang hinunter, und die sind – klar – schön flach. Also suchen wir uns einen Platz auf einer der Terrassen und entdecken zu unserer Überraschung auch noch eine Quelle mit frischem Wasser. Der Abend ist gerettet.
Als wir unser Zelt aufgestellt haben, ist es bereits ziemlich dunkel. Wir schauen uns noch ein wenig um und stellen fest, dass wir hier gar nicht so allein sind wie gedacht. Auf einer der Mauern neben uns krabbelt eine stattliche Spinne herum. Das Tier hat locker die Größe meiner Hand und flößt uns durchaus Respekt ein. Nach einer Weile merken wir, dass sie nicht die einzige ihrer Art ist – in den Löchern der Mauern rundherum wohnen etliche ihrer Verwandten. Heute Nacht wird das Zelt dann besonders sorgfältig verschlossen.
Choquequirao Tag 4; 8 km, 600 Hm bergab, 1.200 Hm bergauf
Am Morgen ist von unseren Spinnennachbarn nichts mehr zu sehen. Nach dem Frühstück geht es zunächst noch ein gutes Stück weiter bergab. Wie schon an den Vortagen müssen wir erst tief ins Tal und anschließend wieder rauf. Unten queren wir den Río Blanco, der zwar nicht besonders breit ist, dessen Brücke aber nur aus einer Holzplanke besteht, die von einem Ufer zum anderen führt. Mit schwerem Rucksack eine durchaus spannende Balance-Übung.
Dann geht’s wieder hoch – 1.200 Höhenmeter bis zu den nächsten Übernachtungsmöglichkeiten. Auch dieser Anstieg ist irgendwann geschafft, und wir fragen bei Familie Pérez nach, ob sie ein Zimmer oder zumindest einen Platz für unser Zelt haben. Nach kurzer Diskussion beschließen wir, uns nicht nur ein Zimmer, sondern auch ein gutes Abendessen und Frühstück zu gönnen. Während wir auf das Essen warten, gibt es schon einmal ein kühles Bier zum Tagesabschluss.
Unser Zimmer ist etwas speziell: Im Grunde ist es ein alter, ziemlich undichter Schuppen, in dem auf der Innenseite alles mit weißer Plane abgehängt ist, damit es halbwegs dicht wird. Luft bekommen wir durch zwei undichte Türen und den Boden.
Beim Abendessen lernen wir noch Romulus, den Mann unserer Gastgeberin (deren Namen ich leider vergessen habe), kennen. Er bricht morgen mit zwei jungen Burschen und einigen Maultieren und Pferden auf, um Touristen am Ausgangspunkt der Wanderung nach Choquequirao abzuholen. Sie laufen also den gesamten Weg, den wir in den letzten drei Tagen gegangen sind, in die andere Richtung zurück. Dafür starten sie sehr früh, damit sie die Touristen am Nachmittag in Empfang nehmen und die erste Etappe gleich wieder mit ihnen zurücklaufen können. Sie legen an einem Tag gut 40 Kilometer zurück, 3.000 Höhenmeter bergauf und 4.000 bergab – und müssen dabei die ganze Zeit ihre Tiere im Blick behalten.
Letzte Etappe und Ankunft in Yanama
Choquequirao Tag 5; 8 km, 1.100 Hm bergauf, 500 Hm bergab
Als die drei schon längst unterwegs sind, bekommen wir am nächsten Morgen ein sehr gutes Frühstück und starten dann zur letzten Etappe. Es geht noch einmal mehr als 1.000 Meter hinauf zum Paso San Juan. Davor kommen wir an der Mina Victoria vorbei. Hier wird Gestein in Handarbeit aus dem Stollen geholt, draußen von Hand zerkleinert und anschließend mit Maultieren über den Berg auf die andere Seite ins Tal gebracht. Die Arbeit sieht hart aus und erinnert uns an die Minen in Potosí in Bolivien, die wir im letzten Jahr besucht haben. Allerdings scheint es hier deutlich gemächlicher zuzugehen, und die Arbeiterinnen und Arbeiter sehen wesentlich gesünder aus als ihre bolivianischen Kollegen.
Oben am Pass treffen wir Jacob aus Neuseeland und seinen Kumpel wieder, die wir gestern Abend in unserer Unterkunft kennengelernt haben. Dann geht es hinunter nach Yanama. Unterwegs kommen wir an einer weiteren Mine vorbei, und Delphine spricht ein paar der Arbeiter an, die draußen Steine sortieren und zerkleinern. Dabei kommen wir mit einer der Frauen ins Gespräch, die uns spontan anbietet, in Yanama in ihrem „Hostel“ zu übernachten. Wir sollen mit ihrem Neffen schon einmal vorgehen; er zeigt uns, wohin wir müssen. Also laufen wir mit dem Zwölfjährigen hinunter ins Tal. Unterwegs ruft er den beiden Neuseeländern noch zu, dass wir eine Unterkunft haben.
Es geht über einen langgezogenen, spektakulär an einen steilen Hang gebauten Weg hinunter, während uns der Jan Pierre, der Enkel unserer Gastgeberin nach einer Weile ein paar Legenden aus dem Tal erzählt. Zum Beispiel von den Mukkis, die kleine Kinder entführen, wenn sie alleine in den Bergen unterwegs sind. Man kann die Ungeheuer aber mit Alkohol und Cocablättern besänftigen, dann sind sich nicht mehr so böse. Unser „Hostel“ entpuppt sich als Haus unserer Gastgeber, in dem kurzerhand ein Raum für uns freigeräumt wird. Und so haben wir schon wieder eine feste Unterkunft für die Nacht. Später werden wir von unserer Gastgeberin bekocht, und sie organisiert uns einen Cousin, der uns am nächsten Tag aus dem Dorf nach Santa Teresa fahren soll.
Damit haben wir diesen zwar technisch nicht extrem schwierigen, aber durch die langen und steilen Auf- und Abstiege doch sehr anstrengenden Trek geschafft. Wahrscheinlich war das auch die letzte der ganz langen Touren für uns in Südamerika.
Am Morgen laufen wir kurz vor sechs ins Dorf, wo unser Transport kommen soll. Letztlich taucht er erst ein paar Stunden später auf und möchte dann erst einmal etwas essen. Nach ein paar Diskussionen – er ist plötzlich mit der Bezahlung nicht mehr zufrieden, und wir sind nicht bereit, mehr zu zahlen – geht es endlich los nach Santa Teresa. Zum ursprünglich vereinbarten Preis und mit einem zunächst etwas mürrischen Fahrer.
Die zwei Neuseeländer steigen unterwegs aus, um noch zwei Tage nach Aguas Calientes zu laufen. Wir wollen den kürzeren Weg nehmen und steigen in Santa Teresa in ein Collectivo um, das uns nach Hidroeléctrica bringt. Von dort geht es dann per Zug oder zu Fuß weiter nach Aguas Calientes, den Talort von Machu Picchu.
Choquequirao, Karte mit GPS Trek
Machu Picchu
Nachdem wir von vielen Freunden und Bekannten gehört haben, dass man für Machu Picchu oft auch relativ kurzfristig noch Tickets bekommt, wenn man ein bis zwei Puffertage einplant, beschließen wir, uns dieses wohl bekannteste Touristen-Highlight in Südamerika auch anzuschauen. Wir fahren mit unserem Collectivo von Santa María bis zum letzten mit dem Auto erreichbaren Punkt, Hidroeléctrica. Genau genommen ist das kein richtiger Ort, sondern eine Haltestelle des Zuges nach Machu Picchu mit ein paar Kiosken und Hostels – und vor allem einem Wasserkraftwerk, das dem Platz seinen Namen gibt. Von hier aus könnten wir den Zug nehmen, etwa 50 US-Dollar für gut zehn Kilometer – da soll noch jemand sagen, die deutsche Bahn sei teuer – oder einfach entlang der Bahnstrecke laufen. Wir entscheiden uns zu laufen; auf die paar Kilometer kommt es jetzt auch nicht mehr an. Nach einem kurzen Stopp geht es los, immer an den Gleisen entlang. Verlaufen unmöglich.
Aguas Calientes oder Machu Picchu Pueblo
Nach etwa zweieinhalb Stunden erreichen wir Aguas Calientes, oder Machu Picchu Pueblo, wie der Ort auch heißt. Dieses kleine, sehr enge Städtchen ist wirklich speziell: Seine Existenzgrundlage ist ausschließlich der Tourismus für Machu Picchu. Von hier fahren im Minutentakt Busse hinauf zur eigentlichen Inkastadt, und mit der Bahn oder zu Fuß kommen die Touristen aus Cusco, dem Heiligen Tal oder eben von Hidroeléctrica in Scharen an. Sämtliche Busse und Autos im Ort sind übrigens ebenfalls per Zug von Hidroeléctrica hinauftransportiert worden – zum Teil in Einzelteilen.
Wir laufen ins Zentrum und kommen auf dem Weg zu unserer Unterkunft schon an der langen Schlange vor dem Ticketbüro vorbei. Wir wissen inzwischen grob, wie das hier läuft: Man stellt sich morgens irgendwann zwischen vier Uhr und halb sieben – je nach Saison – an, zieht eine Nummer und kommt dann am Nachmittag wieder. Wird man aufgerufen, darf man hinein und sich aus den noch verfügbaren Tickets eines aussuchen. Die Tickets sind zum einen nach verschiedenen Routen durch Machu Picchu gestaffelt und zum anderen nach Eintrittszeiten. Wer also sehr früh für seine Nummer ansteht, hat fast freie Auswahl aus den knapp 1.000 Resttickets pro Tag, wer später kommt, muss nehmen, was übrig ist. Die Details ändern sich immer wieder, und wir merken schnell, dass es quasi unmöglich ist, jemanden zu erwischen, der einem das System in Ruhe erklärt.
Vor dem Gebäude stehen nur Wachleute, die auf Nachfragen eher irritiert schauen und so tun, als sei völlig selbstverständlich, wie alles abläuft – als wäre das überall auf der Welt exakt so geregelt und die ganzen Gringos hätten es einfach noch nicht kapiert. Wir bringen zuerst unser Gepäck ins Hotel und stellen uns dann am Abend für die allerletzten Resttickets an, in der Hoffnung, wenigstens jemanden mit Ahnung sprechen zu können. Nach über zwei Stunden dürfen wir schließlich in die heiligen Hallen des Ticketbüros. Dort erfahren wir zum einen, dass es für uns interessante Tickets heute keine mehr gibt, und zum anderen, dass wir ohne unsere Originalreisepässe – die sicher in Cusco bei Pedro liegen – sowieso nichts bekommen.
Na toll. Wie immer sind wir nur mit Kopien unterwegs, während die Originale im Auto liegen – so empfiehlt es offiziell übrigens auch die peruanische Regierung. Nun hören wir, dass wir mit Kopien nicht nach Machu Picchu dürfen. Es gibt eine vage Aussage, dass Kopien zusammen mit einer Kreditkarte auf denselben Namen vielleicht reichen, vielleicht aber auch nicht. Großartig.
Im Hotel sprechen wir mit dem Besitzer, der sich für uns erkundigt und Hilfe verspricht, die am Ende leider auch im Sande verläuft. Also stehen wir am nächsten Morgen um sechs Uhr wieder in der Schlange. Die Hochsaison ist zwar vorbei, aber wir haben eine Woche mit vielen Schulklassen und Studentengruppen erwischt, daher sind wir gar nicht so früh dran, wie gedacht. Irgendwann sind wir im Gebäude. Die Schlange führt eine Treppe hinauf, im ersten Stock an einer Ausstellung über Machu Picchu vorbei und dann wieder hinunter, wo schließlich die Dame sitzt, die über die Nummern wacht – und ihre Macht sichtlich genießt.
Keine Reisepässe, keine Nummer. Sie erklärt, sie würde uns die Nummer ja geben, aber an der Kasse bekämen wir dann ohnehin kein Ticket. Zum Glück bleibt Delphine hartnäckig. Die Angestellte macht sich schließlich doch die Mühe, unsere Ausweisnummern von den Kopien händisch in das System einzutragen – sichtlich widerwillig – und am Ende bekommen wir unsere Nummern.
Am Nachmittag laufen wir erneut zum Ticketbüro und kommen diesmal relativ einfach zu unseren Eintrittskarten. Nur beim Ticket für den Bus heißt es wieder: Ohne Reisepass geht nichts. Ernsthaft? Wir bekommen ein Ticket für die berühmteste Sehenswürdigkeit des Landes, aber kein Ticket für den Bus hinauf? Delphine erklärt geduldig, warum wir unsere Reisepässe für eine mehrtägige Bergtour nicht dabeihatten. Offenbar ist der zuständige Herr von unserer Strecke über Choquequirao beeindruckt, jedenfalls verkauft er uns schließlich doch Bustickets. Jetzt müssen sie uns morgen nur noch reinlassen.
Zwischen all dem Ticket-Hin-und-Her verbringen wir die restliche Zeit damit, gemütlich in Cafés zu sitzen, zu essen und die Läden im Ort zu erkunden. Es gibt zahllose Geschäfte mit billigem Nippes, aber auch ein paar schöne Läden mit lokalem Kunsthandwerk. Vor allem sind wir froh, dass am Ende doch alles geklappt hat und wir am nächsten Tag nach Machu Picchu dürfen.
Machu Picchu
Und dann geht es mit dem Bus hinauf nach Machu Picchu. Weder im Bus noch am Eingang gibt es Probleme wegen der fehlenden Reisepässe, und irgendwann stehen wir tatsächlich vor den ersten Ruinen der alten Inkastadt. Die Mauern und Gebäude erinnern in ihrer Art sehr an das, was wir in Choquequirao gesehen haben, aber hier ist deutlich mehr freigelegt, sodass sich ein viel vollständigeres Bild der Anlage ergibt.
Einmal im Gelände dürfen wir uns so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Wir lassen immer wieder größere Gruppen vorbeiziehen und nehmen uns die Ruhe, die Ruinenstadt in unserem eigenen Tempo zu erkunden. Über vier Stunden schlendern wir durch diesen vermutlich touristischsten aller Orte in Südamerika. Und man muss zugeben: Die Besucherlenkung funktioniert erstaunlich gut. Zwar ist es voll, aber man hat trotzdem immer wieder Momente, in denen man stehenbleiben, schauen und fotografieren kann, ohne von der Masse weitergeschoben zu werden.
Gleichzeitig sind die mehr als 4.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag nach Ansicht vieler Wissenschaftler deutlich zu viel für die alten Bauwerke, die ohnehin über die Jahrhunderte und durch zahlreiche Erdbeben stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Für den peruanischen Staat ist der Besucherstrom dagegen ein lukratives Geschäft: Eintritt, Bus, Zug, Führungen – zusammen summiert sich das auf viele Millionen US-Dollar im Jahr.
Zurück ins Tal und nach Cusco
Nach unserem Ruinenbesuch geht es mit dem Bus wieder hinunter nach Aguas Calientes. Dort schultern wir in unserem Hotel die großen Wanderrucksäcke und laufen in der Dämmerung erneut entlang der Gleise zurück ins Tal. Bis wir unten sind, ist es dunkel, und wir richten uns innerlich schon darauf ein, unser Zelt irgendwo im Gebüsch aufzuschlagen. Viel Essen oder Wasser haben wir nicht mehr, und es wirkt, als wäre hier unten nichts mehr los – entsprechend gering schätze ich unsere Chancen ein, noch eine Mitfahrgelegenheit nach Santa Teresa zu finden.
Doch unten am Parkplatz steht tatsächlich noch ein Kleinbus, dessen Fahrer sich großzügig bereit erklärt, uns mitzunehmen – zu einem ebenfalls sehr großzügigen Preis. Delphine verhandelt kurz, und am Ende wird der Fahrpreis halbwegs angemessen. So kommen wir noch am Abend nach Santa Teresa, finden eine Unterkunft und können auf dem Fest, das gerade im Ort gefeiert wird, noch etwas Leckeres zum Abendessen ergattern.
Delphine schafft es sogar, nach einigen ziemlich komplizierten Telefonaten ihre Wanderstöcke wiederzubekommen, die sie im Collectivo von Yanama nach Santa Teresa liegen gelassen hatte. Zuvor stand eine kleine Sherlock-Holmes-Recherche nach der Nummer des Fahrers an, der sichtlich erstaunt war, über welche Umwege sie an seine Kontaktdaten gekommen ist. Letztlich treffen sich die beiden kurz in Santa Teresa, und Delphine hält ihre nicht mehr ganz jungen, aber treuen Wanderstöcke wieder in der Hand.
Dann geht es durch Sonnenschein, Regenschauer und schließlich sogar Schneetreiben über Täler und Pässe zurück nach Cusco. Unser Gepäck thront als beeindruckend hoher Stapel oben auf dem Kleinbus – immerhin mit einem ordentlichen Netz und einer stabilen Plane gesichert.
Jetzt haben wir also sowohl die Ruinen von Machu Picchu als auch die von Choquequirao gesehen – zwei sehr besondere Orte. Machu Picchu ist extrem touristisch und komplett auf über eine Million Besucher pro Jahr ausgelegt, während Choquequirao noch in der Ausgrabung ist und nur über eine der anstrengendsten Wanderungen der Region erreichbar bleibt. Beide Orte sind spannend und haben ihren ganz eigenen Reiz. Aber jedem, der zu Fuß halbwegs fit ist und sich nicht vor ein paar heißen, schweißtreibenden Auf- und Abstiegen scheut, würde ich empfehlen, sich auch Choquequirao anzusehen. Schon allein, weil man dort noch besser spürt, welchen Aufwand die Inka betrieben haben, um an diesen abgelegenen Orten – mit tatkräftiger Unterstützung ihrer versklavten Nachbarn – ihre Städte, Kultstätten oder was auch immer genau sie waren, in Stein zu meißeln.
Adios Peru
Zurück in Cusco bereiten wir uns auf die Weiterfahrt vor. Es gibt noch ein paar Dinge an Pedro zu reparieren, und wir verbringen einen letzten schönen Abend mit Bernhard und Brigitte in ihrem schicken Camper, bevor es weiter in Richtung Bolivien geht. So langsam macht sich eine leise Wehmut breit. Peru ist das letzte Land, das wir noch einmal ausgiebig bereisen wollten. Zwar haben wir noch einige Pläne in Bolivien und Argentinien, aber im Grunde geht es nun mehr oder weniger direkt nach Santiago de Chile, wo wir Ende November Pedro an seine nächsten Besitzer übergeben werden. Jetzt ist es immerhin schon Oktober.
Also geht es nach einem weiteren Tag in Cusco raus aus der Stadt Richtung Titicacasee. Unterwegs besichtigen wir noch die Kirchen von Oropesa, Andahuaylillas und Huaro und übernachten schließlich auf dem Fußballplatz von Checacupe.
Pallay Punchu
Bevor wir die Grenze hinter uns lassen, wollen wir – mal wieder – ein paar bunte Berge besuchen. Südlich von Cusco, in der Region rund um den berühmten Ausangate, liegen die sogenannten Rainbow Mountains: Berglandschaften, deren Hänge durch verschiedene Mineralien in allen möglichen Farben leuchten – vor allem kräftiges Rot, aber auch Grün, Blau und Gelb. Täglich werden dort tausende Bilder gemacht, oft mit einem Lama im Vordergrund, damit Instagram und Co gut bedient sind.
Diese Rainbow Mountains sind sicher beeindruckend, aber die Vorstellung, uns erneut mit riesigen Menschenmassen ein weiteres „Must-see“ anzuschauen, begeistert uns nur mäßig. Stattdessen wollen wir den Pallay Punchu besuchen – vermutlich nicht weniger bunt, aber deutlich weniger überlaufen und praktischerweise auch auf unserer Route. Also fahren wir, mit ein paar Stopps bei verschiedenen Kirchen und einem netten Thermalbad, auf dessen Parkplatz wir gleich übernachten können, zur Abzweigung der Straße, die hinauf zum Pallay Punchu führt.
Mit Pedro kommen wir dort allerdings nicht weiter: zu eng, zu steil, zu viel Schotter. Nach kurzer Suche finden wir jedoch an der Straße einen Taxifahrer, der bereit ist, uns hinaufzufahren und oben auf uns zu warten. So lassen wir uns ganz bequem hochfahren – und bereuen die Entscheidung keine Sekunde. Pedro schafft erstaunlich viel, auch Strecken, die angeblich nur mit Allrad machbar sind, aber hier wäre er ziemlich sicher gescheitert.
Ein bisschen laufen müssen wir oben trotzdem. Auf einem längeren Rundweg geht es mehr oder weniger direkt auf die bunten Felsen zu. Das Wetter ist zwar eher grau, aber hin und wieder bricht doch etwas Sonne durch und lässt die Farben der Felsen fast surreal leuchten.
Bei den Urus auf den schwimmenden Inseln
Dann fahren wir wieder hinunter und weiter zu unserem nächsten – und endgültig letzten – Stopp in Peru: den „Islas flotantes“, den schwimmenden Inseln bei Puno. Hier leben Menschen der Volksgruppe der Urus seit Jahrhunderten auf schwimmenden Schilfinseln, die sie ursprünglich wohl aus Sicherheitsgründen – auf dem offenen Wasser des Titicacasees war man schwerer anzugreifen – und wegen der einfacheren Nahrungsbeschaffung durch Fischfang direkt vor der Haustür entwickelt haben.
Es geht noch einmal durch das peruanische Hochland, durch weite, offene Landschaften, bis wir am Horizont einen großen blauen Fleck sehen. Als wir näher kommen, leuchtet uns der riesige Titicacasee entgegen. Aufgrund seiner Lage – auf der bolivianischen Seite umringt von teils über sechstausend Meter hohen Bergen, auf der peruanischen Seite eingebettet in eine Hochebene mit weiten Flächen und einigen hohen Gipfeln – hat der See ein eigenes Mikroklima, das für erstaunlich stabiles, sonniges Wetter sorgt. Regen ist selten, und das Wasser kam – zumindest bis die Klimaveränderungen spürbarer wurden – verlässlich aus den umliegenden Bergen.
Wir fahren durch die etwas chaotische Stadt Puno hinunter zum See und übernachten direkt am Ausgangspunkt unserer für den nächsten Tag geplanten Tour zu den schwimmenden Inseln.
Nach dem Frühstück gehen wir zum Anleger und warten auf unseren Guide. Der hat heute keine Zeit und schickt stattdessen seine Mutter, Mama Rosa, die uns gut gelaunt begrüßt und direkt auf ihr Boot lotst. Man könnte hier aus einer Vielzahl von Touranbietern wählen, aber wir haben von mehreren Reisenden gehört, dass sie mit der Familie von Mama Rosa unterwegs waren und es sehr empfehlen können. Ihre Familie lebt teilweise noch selbst auf einer der Inseln und verdient durch die Besuche von Touristen einen guten Zuverdienst – wenn nicht mittlerweile sogar den größten Teil ihres Einkommens.
Wir fahren mit Rosa durch einen langen Kanal, der bei dem derzeit niedrigen Wasserstand noch auf den See hinausführt, und weiter zu den Inseln. In den letzten Jahren hat es fast keinen Niederschlag gegeben, und der Pegel des Titicacasees sinkt zusehends. Ganz austrocknen wird er durch die umliegenden Gletscher wohl in absehbarer Zeit nicht, aber wenn diese Gletscher – wie derzeit vielerorts – weiter so schnell schmelzen, wird sich auch hier einiges verändern.
Die schwimmenden Inseln wirken aus der Entfernung wie eine große, zusammenhängende Fläche, sind aber in Wirklichkeit viele einzelne, miteinander verbundene Inseln, die jeweils einige Gebäude tragen. Meist gehört eine Insel einer Familie, mit mehreren kleinen Hütten darauf. Daneben gibt es Inseln mit der Schule, einem Restaurant, einer Kirche und anderen gemeinschaftlichen Einrichtungen.
Wir steigen zunächst an Rosas Insel aus und bekommen eine ausführliche Erklärung zum Bau der Inseln und der typischen Boote, die ebenfalls aus Schilf und Holz gefertigt werden. Die Inseln bestehen aus vielen rechteckigen Blöcken aus Wurzelwerk und getrocknetem Schilf, die fest zusammengebunden werden; oben drauf kommt immer wieder eine neue Schicht frischen Schilfs, wenn das untere Material nach und nach verrottet. Die Bewohner müssen daher ständig Schilf nachernten und ihre Inseln ausbessern. Auch die Hütten werden immer wieder leicht versetzt, wenn neue Schichten aufgelegt werden. Dieser dauernde Aufwand ist einer der Gründe, warum viele Familien das Leben auf den Inseln aufgegeben und aufs Festland gezogen sind.
Wir spüren deutlich, wie der Boden unter uns nachgibt – mal mehr, mal weniger, aber das ganze Konstrukt schwingt spürbar unter unseren Füßen. Der Vortrag von Mama Rosa geht irgendwann recht nahtlos in ein Verkaufsgespräch über: Auf den Inseln werden viele Handarbeiten hergestellt, die später an die Besucher verkauft werden – von kleinen Schilfanhängern bis hin zu großen Wandteppichen. Wir entscheiden uns für einen kleinen Anhänger, aus finanziellen, aber auch aus Platzgründen.
Danach geht es zur nächsten Station: der Schule, die natürlich ebenfalls auf einer schwimmenden Insel steht. Wir bekommen eine Mini-Führung von Rosas Enkeltochter, und vor allem wollen alle Kinder fotografiert werden. Viel Überredung braucht es dafür nicht. Lustig ist zu sehen, wie die Kinder über ihren „Schulhof“ rennen und sich mit Anlauf immer wieder auf den Boden werfen – der weiche Schilfteppich verzeiht so einiges.
Zum Schluss fahren wir noch zu einer Art Restaurantinsel – eher ein Kiosk mit ein paar Tischen davor, natürlich ebenfalls schwimmend. Eigentlich wollten wir nichts mehr essen, aber ein bisschen bestellen wir dann doch. Mama Rosa will währenddessen „kurz tanken fahren“, damit sie uns später wieder ans Festland bringen kann. Ob sie wirklich tankt oder der Deal eher darin besteht, den Gästen einen kleinen Zwangsaufenthalt im Restaurant zu verschaffen, bleibt ihr Geheimnis – wir warten jedenfalls eine ganze Weile, beobachten die Boote und Inseln um uns herum und lassen die Szenerie auf uns wirken.
Am Ende holt sie uns wieder ab und bringt uns zurück nach Puno. Die Tour wirkt stellenweise wie eine perfekt einstudierte Verkaufsshow, ist aber trotzdem spannend, und Mama Rosa ist eine herzliche, humorvolle Begleiterin, sodass wir den Ausflug keinesfalls bereuen. Zum Abschied bekommen wir sogar noch einen weiteren Stroh-Anhänger geschenkt – eine Art Mobile mit einem typischen Schilfboot und einem Kondor, der darüber fliegt.
Tja, und dann war’s das für uns mit Peru. Von Puno aus folgen wir noch ein Stück der Küste des Titicacasees in Richtung bolivianische Grenze und überqueren schließlich die Grenze nach Bolivien.
Wir haben unsere Zeit in Peru sehr genossen. Das Land bietet unglaublich vielfältige Landschaften – von wüstenartigen Küsten über schneebedeckte Andengipfel bis hin zum Regenwald – und viele freundliche, offene Menschen. Auch wenn manche Begegnungen etwas ruppig oder mürrisch beginnen, haben wir doch immer wieder liebe, interessante und hilfsbereite Menschen kennengelernt.
Was uns sehr erschreckt hat, ist das Müllproblem. Vor allem entlang der Küste liegen stellenweise kilometerweit Plastikabfälle an den Straßenrändern, und rund um Lima finden sich ganze Flächen, die auf Schichten von Müll aufgebaut sind. Selbst in den Bergen sieht man auf beliebten Trekkingrouten viel Plastikmüll, der leider oft von einheimischen Mulitreibern achtlos weggeworfen wird.
Trotzdem bleibt Peru für uns ein wunderschönes Reiseland – mit einzigartigen Landschaften, spannender Geschichte und vielen Momenten, an die wir noch lange zurückdenken werden.